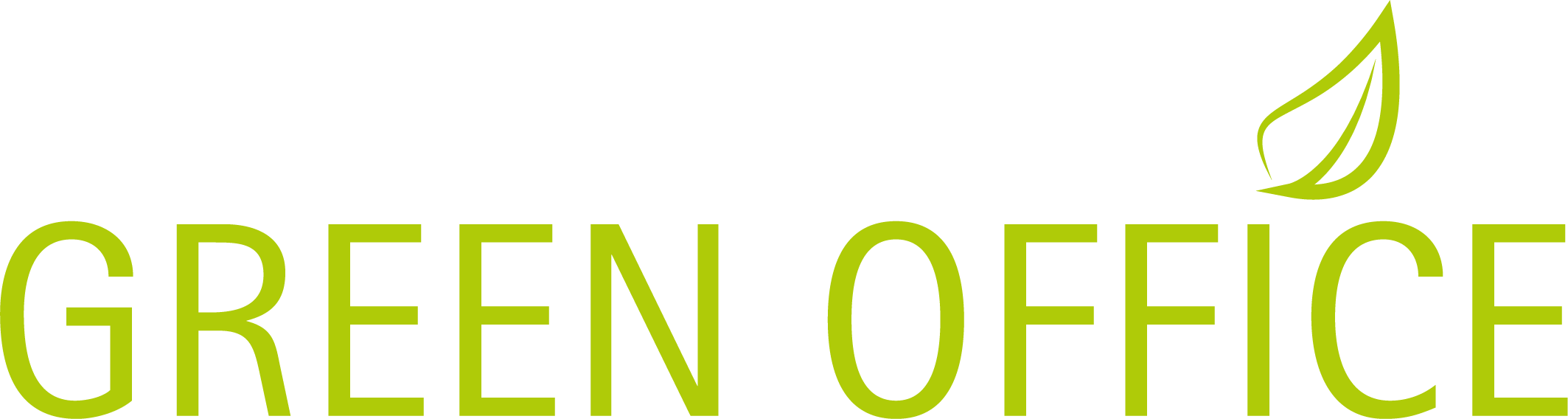Modifizierte Edelmetalloberflächen für neuronale Elektroden
- verfasst von
- Kim Dana Kreisköther
- betreut von
- Peter Behrens
- Abstract
Ertaubung bedeutet nicht nur den Verlust eines Sinnesorgans, es führt in vielen Fällen zur gesellschaftlichen Isolation. Die Anzahl der Gehörgeschädigten steigt jedes Jahr an, weshalb die Weiterentwicklung von Hörhilfen eine wachsende gesellschaftliche Rolle spielt. Eine Maßnahme zur Wiedererlangung der auditiven Wahrnehmung ist das Einsetzen des Cochlea-Implantats, wodurch jedoch nicht der optimale biologische Zustand wiederhergestellt werden kann. Daher widmet sich der erste Teil der vorliegenden Arbeit der Etablierung eines implantatassoziierten Wirkstofffreisetzungssystems, im zweiten Teil der Arbeit werden Ansätze zur biochemischen Modifizierung zur Verbesserung der Elektroden-Nerven-Interaktion untersucht. Die Kontakte neuronaler Elektroden bestehen üblicherweise aufgrund seiner chemischen Inertheit, der sehr guten Leitfähigkeit und der guten Biokompatibilität aus dichtem Platin. Um eine Wirkstofffreisetzung von den Platin-Kontakten zu erreichen, werden diese in der vorliegenden Arbeit mit einer Beschichtung aus nanoporösem Platin versehen und charakterisiert. Poren mit unterschiedlichen Durchmessern können als Reservoir für Wirkstoffe variierender Größe genutzt werden. Durch die Kombination einer elektrochemischen Abscheidung und einer templatbasierten Synthese sollen die Vorteile einer kontrollierten Beschichtungsmethode zur Generierung von Poren genutzt werden. Durch die Schichtdickenvariation der nanoporösen Beschichtung sowie durch chemische Modifizierung soll ein einstellbares Wirkstofffreisetzungssystem erzeugt werden. Freisetzungsversuche zeigen, dass die chemische Modifizierung keinen Einfluss auf das Freisetzungsverhalten aufweist. Durch Variation der Beschichtungsdicke wird ein einstellbares Freisetzungssystem aus der nanoporösen Platinbeschichtung erzeugt. Die elektrochemischen Eigenschaften können durch die Beschichtung mit nanoporösem Platin verbessert werden, dies wird auf die erhöhte spezifische Oberfläche zurückgeführt. Zellkulturuntersuchungen zeigen eine gute Cytokompatibilität. Abschließend werden reale Elektrodenkontakte eines Cochlea-Implantats mit der entwickelten nanoporösen Platinbeschichtung versehen, um die Übertragbarkeit der entwickelten Beschichtung in die Anwendung nachzuweisen. In einem zweiten Ansatz wird zur Verbesserung der Elektroden-Nerven-Interaktion die Modifizierung von Edelmetalloberflächen mit dem neuronalen Adhäsionsmolekül L1CAM untersucht. Qualitative Aussagen über die aufgebrachte immunologisch aktive L1CAM-Menge können unter Verwendung eines antikörperbasierten Nachweisverfahrens getroffen werden. Zur Evaluierung der Ergebnisse wird dieser zum einen direkt auf der Substratoberfläche durchgeführt, zum anderen wird die Konzentration indirekt durch elektrochemische L1CAM-Ablösung ermittelt.
- Organisationseinheit(en)
-
AG Anorganische Festkörper- und Materialchemie
- Typ
- Dissertation
- Anzahl der Seiten
- 233
- Publikationsdatum
- 2021
- Publikationsstatus
- Veröffentlicht
- Ziele für nachhaltige Entwicklung
- SDG 3 – Gute Gesundheit und Wohlergehen
- Elektronische Version(en)
-
https://doi.org/10.15488/11548 (Zugang:
Offen)